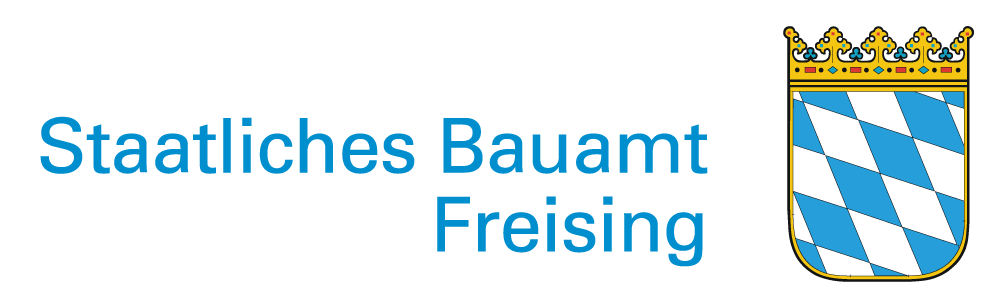- Umweltschutz
Naturschutz beim Ausbau des Föhringer Rings (St 2088)
Beim Ausbau des Föhringer Rings (Staatsstraße 2088) ist der Schutz von Natur und Landschaft ein zentrales Anliegen. Baustellen bedeuten immer einen Eingriff – daher gilt die gesetzliche Maxime:
- Eingriffe vermeiden, wenn möglich
- unvermeidbare Eingriffe minimieren und
- ausgleichen (kompensieren)
Alle naturschutzfachlichen Maßnahmen sind im landschaftspflegerischen Begleitplan festgelegt:

Vermeidungsmaßnahmen während der Bauzeit
Flächenverbrauch minimieren: Es wird nur die zwingend erforderliche Fläche in Anspruch genommen. Sensible Bereiche werden möglichst geschont.
Lebensräume schützen: Angrenzende Lebensräume werden durch stabile Zäune gesichert.
Schonung der Vogelbrut: Gehölze werden ausschließlich außerhalb der Brutzeit entfernt. Baustraße mit Rücksicht auf Tierwelt: Für die Zuwegung zur Isarbrücke wurde eine möglichst kurze und tierfreundliche Variante durch die Isarauen gewählt.
Wiederherstellung von Flächen: Zeitweise beanspruchte Flächen (z. B. Straßenböschungen) werden nach Ende der Bauarbeiten wieder angesät oder bepflanzt wie zuvor.
Artenschutz vor Baumfällarbeiten: Mit Hubsteiger und Endoskop wird geprüft, ob streng geschützte Arten wie Fledermäuse oder Vögel in Bäumen leben. Falls ja, werden Ersatzhabitate geschaffen.
Fledermausschutz:
- Über zehn Fledermausarten im Umfeld
- Bauzeitliche Fledermauszäune dienen als Orientierungshilfe
- Dauerhafte Überflughilfen (4–5 m hohe Wände auf 740 m Länge) an den Brücken verhindern Kollisionen mit Fahrzeugen
Reptilienschutz: Ein bauzeitlicher Schutzzaun verhindert das Eindringen der Zauneidechse in die Baustelle.
Kleintierschutz: Eine dauerhafte Leiteinrichtung verhindert das Betreten der Fahrbahn durch kleine Säugetiere.
Umweltbaubegleitung: Während der gesamten Bauzeit werden die Wirksamkeit der Maßnahmen sowie sonstige Vorgaben nach Umweltrecht kontrolliert.
Ausgleichsmaßnahmen (Kompensation)
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sind Eingriffe nicht vollständig vermeidbar. Diese müssen gesetzlich ausgeglichen werden. Da es im Münchner Stadtgebiet kaum geeignete Flächen gibt, wurden Flächen in folgenden Gemeinden erworben: Aschheim, Ismaning, Baierbrunn, Brunnthal und Marzling. Dort werden insgesamt rund 7,9 Hektar ökologisch aufgewertet – das entspricht etwa 11 Fußballfeldern.
Geplant sind unter anderem:
- Laub- und Auenwälder
- Streuobstwiesen
- Artenreiche Magerrasen, Frisch- und Feuchtwiesen
- Laichgewässer für Amphibien
- Lebensräume für Zauneidechsen
Eindrücke der Maßnahmen




Klimaschutz im Straßenbau – Pflicht und Verantwortung
Warum Bayerns Behörden das Klimaschutzgesetz anwenden müssen
Klimaschutz ist in Deutschland gesetzlich verpflichtend – nicht nur in der Energie- oder Industriepolitik, sondern auch im Verkehrsbereich. Der Straßenbau fällt dabei ausdrücklich unter die Regelungen des Bundes-Klimaschutzgesetzes (KSG). Dieses Gesetz gibt für alle Sektoren verbindliche CO₂-Budgets und Minderungsziele vor – auch für den Freistaat Bayern.
Das bedeutet: Alle Infrastrukturprojekte im Straßenbau – ob Neubau oder Ausbau – müssen daraufhin geprüft werden, welche Treibhausgaswirkungen sie verursachen und wie sie sich langfristig auf das globale Klima auswirken.
Fachliche Grundlage: Das FGSV-Arbeitspapier
Für diese Prüfung wenden Bayerns Behörden – darunter das Staatliche Bauamt Freising – das Fachpapier der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) an: „Klimawirksame Emissionen im Straßenwesen – Bilanzierung und Bewertung“
Dieses Arbeitspapier stellt sicher, dass:
- alle klimarelevanten Quellen (Bau, Material, Flächen, Betrieb) erfasst werden,
- Emissionen nach dem neuesten Stand der Technik berechnet werden,
- die Klimawirkung über den gesamten Lebenszyklus der Straße betrachtet wird.
Föhringer Ring – das Klimagutachten im Überblick
Für den vierstreifigen Ausbau der Staatsstraße 2088 (Föhringer Ring) wurde eine vollständige Klimabilanz erstellt. Das Ergebnis unterscheidet drei Sektoren:
- Sektor Industrie (Bau & Material): + 107,8 t CO₂eq (einmalig)
- Sektor Landnutzungsänderung: ausgeglichen durch Ersatzmaßnahmen (z.B. Gehölzpflanzungen)
- Verkehr (Betrieb): – 864 t CO₂eq pro Jahr durch flüssigeren Verkehr

Wie entstehen die – 864 t CO₂ Einsparung?
Diese Zahl stammt aus der Verkehrsuntersuchung mit Prognose 2035, die speziell für den Föhringer Ring erstellt wurde. Darin wurden zwei Szenarien verglichen:
Nullfall (ohne Ausbau):
Verkehrsbelastung bleibt bei 2-spuriger Führung
-> hoher Stop-and-Go-Anteil, ungleichmäßiger Verkehrsfluss
Planfall (mit Ausbau):
Verkehrsfluss verbessert sich
-> weniger Bremsen, weniger Beschleunigen, gleichmäßigere Fahrweise
Die CO₂-Emissionen wurden mit einem anerkannten Tool des HBEFA (Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs) berechnet.
Ergebnis an einem normalen Werktag:
Nullfall: 894,98 t CO₂eq/Tag
Planfall: 892,29 t CO₂eq/Tag -> Differenz: –2,7 t CO₂eq pro Tag
Die bereinigte Differenz mit Samstagen und Sonntagen beträgt –2,37 t CO₂eq. Hochgerechnet auf 365 (Werktage und Wochenenden) Tage ergibt sich, dass 864 t CO₂eq pro Jahr eingespart werden.
Das bedeutet: Die Straße verursacht im Betrieb jedes Jahr deutlich weniger Emissionen als vorher – trotz leicht steigender Verkehrsmengen.
Fazit: gesetzliche Anforderungen erfüllt, Klimanutzen geschaffen
Das Projekt Föhringer Ring zeigt, wie bayerische Behörden dem Klimaschutzgesetz gerecht werden:
- Vorgaben zum Klimaschutz eingehalten
- Emissionen bilanziert und kompensiert,
- und langfristiger Nutzen nachgewiesen.
Durch die jährliche Einsparung von rund 864 t CO₂eq ist die einmalige Klimawirkung des Baus (rund 107,8 t CO₂eq) bereits nach zwei Monaten vollständig kompensiert.
So entsteht Infrastruktur, die verkehrlich notwendig und klimapolitisch tragfähig ist.